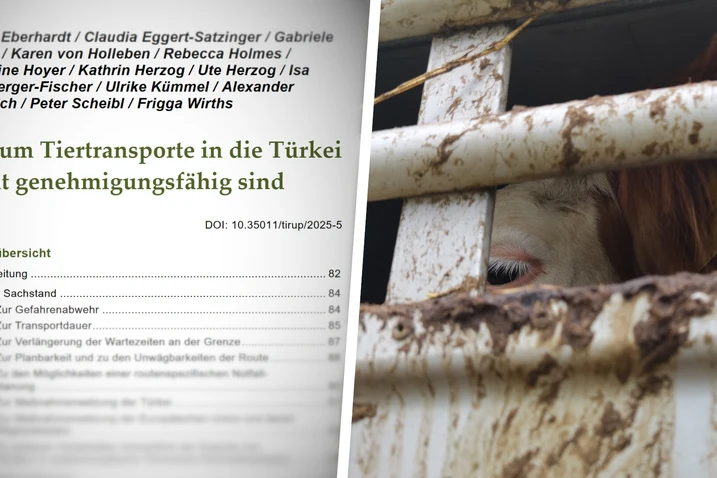Hinweis: Der Inhalt dieses Beitrags in Wort und Bild basiert auf der Faktenlage zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung (06.02.2019)
Wien, 06.02.2019
Das qualvolle Leben auf einer Pelzfarm aus Sicht eines Fuchses erzählt. Diesen berührenden Text hat Tierschutzaktivistin Sandy P. Peng erstmals 2018 bei Pelzdemos in Zürich und Wien vorgetragen.
Ich stehe an einem glitzernden See, es ist Nacht, der Mond scheint hell. Auf der glatten Oberfläche des Wassers kann ich meine Reflexion sehen. Ich bin ein Fuchs, jung und stark, mein Fell glänzt im Mondlicht. Als Einzelgänger bin ich es gewohnt, allein im Wald unterwegs zu sein. Das ist mein natürlicher Lebensraum, hier fühle ich mich wohl. Hier laufe ich stundenlang über den kühlen, weichen Waldboden, fühle die Feuchtigkeit unter meinen Pfoten. Mein Streifgebiet ist viele Hektar groß. Ich fühle mich lebendig. Ich fühle mich frei.
Doch plötzlich wache ich auf, bin zurück in dem Alptraum, den sie „Pelzfarm“ nennen. Hier ist jede einzelne Sekunde meines Daseins eine Qual. Es ist immerzu kalt und zugig. Sie wollen, dass mein ausgelaugter Körper mehr Pelz ansetzt. Ich weiß, dass sie ihn mir dann so qualvoll entreißen werden, dass ich nicht einmal darüber nachdenken kann. Zu oft habe ich bereits die Schreie gehört, von meinen Brüdern und Schwestern, die sie „geerntet“ haben. Und so verbringe ich mein trostloses Leben in einem winzigen Käfig, den ich nur zum Sterben verlassen werde. Es ist eng, der Boden besteht aus Drahtgitter und schneidet mir die Pfoten auf. Stehen schmerzt. Liegen schmerzt. Leben schmerzt.
Ich habe noch nie den kühlen Waldboden unter meinen Füßen gespürt. Bin noch nie durch ein Streifgebiet gelaufen. Ich habe keine Vorstellung davon, wie groß sich mehrere Hektar anfühlen. Ich konnte mich noch nie ausstrecken oder wohlfühlen. Ich war noch niemals allein. Ich habe noch nie ohne Angst gelebt. Ich war noch niemals frei.
Und ich werde niemals frei sein. Ich werde Pelz sein.
Wir sind tausende in dieser Farm. Ich muss mir meinen viel zu engen Käfig mit einem weiteren Fuchs teilen. Er ist männlich, so wie ich. In unserem natürlichen Lebensraum würden wir Rangkämpfe führen oder uns aus dem Weg gehen. Hier können wir uns niemals aus dem Weg gehen. Doch wir kämpfen oft miteinander, bis zur Erschöpfung. Die Enge ruft Aggressionen hervor. Unsere Körper sind von Verletzungen übersät, wir fühlen uns niemals sicher. In anderen Käfigen beobachte ich sogar Kannibalismus, sie beißen sich nicht nur gegenseitig, sie fressen sich auf! Sie fressen sich auch selbst. Viele haben Wunden bis auf die Knochen. Viele werden nicht überleben, bis sie „geerntet“ werden. Ich frage mich, was schlimmer ist.
Fäkalien fallen einfach durch den Gitterboden. Über meinem Käfig stehen noch weitere, die Fäkalien unserer Nachbarn über uns fallen oft von oben in meinen Käfig und weiter auf den Boden der Farm. Häufig werde ich davon getroffen. Es ist nicht nur ekelhaft und unhygienisch. Es verätzt meine Haut. Schmerz ist mein dauernder Begleiter. Gestank erfüllt unsere Luft.
Nahrung und Wasser sind karg. Wir essen es, weil wir Hunger haben, aber es fühlt sich nicht richtig an. Lieber würde ich im Wald sein, etwas jagen oder mir etwas Leckeres zu essen suchen. Nicht diesen Brei, den sie uns lieblos in den Käfig werfen. Das Wasser schmeckt schal. Wenn es in der Nacht zu kalt wird, friert es ein und wir haben nichts zu trinken. In der Freiheit würde ich nur reines, klares Flusswasser trinken. Wenn wir unvorsichtig sind und etwas von unserem Essen oder Wasser verschütten, fällt es durch den Gitterboden nach unten und ist weg. Hunger und Durst sind allgegenwärtig. Wenn wir neues Essen bekommen, bricht überall Streit aus. Mein Mitgefangener versucht mich wegzudrängen, auch er ist hungrig. Manche Füchse werden von dem Brei, der ziellos in unsere Käfige geschüttet wird, getroffen. Ihre Zellengenossen stürzen sich auf sie und verletzen sie. Fressen ihre Haut gleich mit.
Wenn wir gerade nicht kämpfen sitzt mein Zellengenosse nur da. Manchmal geht er auch auf und ab, auf und ab, immer wieder. Er leckt seine Pfoten bis sie bluten. Er sieht durch mich hindurch. Er beißt in die Gitter, die uns gefangen halten. Man nennt das stereotypes Verhalten. Er hat bereits alle Hoffnung aufgegeben. Er ist depressiv. Oft habe ich das Gefühl, dass er gar nicht mehr wirklich da ist. Aber es gibt hier auch nichts zu tun. Wir haben keine Beschäftigungsmöglichkeit. Natürlich wird man früher oder später verrückt. Wir wollen laufen, wir wollen rennen, wir wollen springen, wir wollen graben. Nichts davon können wir hier tun. Nichts davon werden wir je tun. Es ist ein ewiger Trott, tagein tagaus warten wir. Auf Nichts. Auf den Tod. Manchmal gibt es Essen. Irgendwann werden sie uns holen. Dazwischen ab und zu schlafen. Sonst nichts.
Schlaf ist meine einzige Ausflucht aus dieser Hölle. Wenn ich schlafe, träume ich von der Freiheit. Eine Freiheit, die ich niemals haben werde. Schlaf ist hier nicht einfach zu finden. Wir sind so viele, es ist immer laut. Oft höre ich die Schreie und das Klagen von verletzten Artgenossen. Ich habe Angst vor meinem Mitgefangenen, er wird oft ohne Vorwarnung aggressiv und greift mich an. Bequemes Liegen ist auf dem Drahtgitterboden unmöglich. Jede Liegeposition schmerzt. Meist schlafe ich nur wenige Minuten am Stück, bevor mich die Schmerzen wecken und ich mich ein wenig anders hinlegen muss. In eine ebenso unbequeme Position. In der Freiheit würde ich mir ein Nest bauen. Auf weichem Erdboden, in einem Bau, unter der Erde, in Sicherheit. Doch nur diese wenigen Minuten der Freiheit im Schlaf halten mich davon ab, endgültig verrückt zu werden. Depressiv, wie mein Zellengenosse, abwesend.
Jetzt ist November. Bald würde die Paarungszeit beginnen. In anderen Käfigen sehe ich weibliche Füchse. Wenn ich frei wäre, würde ich mir bald eine Partnerin suchen. Wir würden eine Familie gründen, ich würde uns einen Bau graben. Würde jagen, um die Familie zu versorgen. Würde bangen, ob die Kleinen die ersten Wochen überstehen. Aber ich habe noch nie gegraben. Ich werde niemals eine Familie haben.
Für uns beginnt stattdessen nun die „Ernte“. Sie haben bereits angefangen. Ich habe die Schreie gehört. Konnte sehen, wie sie meine Mitgefangenen aus ihren Käfigen zerren, ohne Rücksicht, ohne Mitleid. Sie haben sie mitgenommen. Keiner ist zurück gekehrt. Und bald haben sie auch unseren Käfig erreicht.
Und schon steht ein Mann vor uns. Er ist groß, trägt einen dunklen Overall. Ich habe Angst, versuche mich in den hintersten Winkel des Käfigs zu verkriechen. Er öffnet die Tür. Nein, bitte nicht! Er greift nach meinem Zellengenossen. Dieser reagiert fast gar nicht. Lässt sich greifen. Er wird unsanft in einen Behälter geworfen. Ich kann nicht sehen, was darin ist. Ob ich entkommen kann, während der Mann weggedreht ist? Doch schon ist es zu spät, er greift nach mir. Ich versuche mich zu entwinden, beiße zu. Dafür ernte ich Schläge. In hohem Bogen werde auch ich in den Behälter geworfen. Darin ist nichts, außer einigen Artgenossen. Alle zu Tode verängstigt. Alle aggressiv. Ich will ihnen aus dem Weg gehen, aber ich kann nicht weg. Es gibt keinen Ausweg. Wir beißen uns. Wir kratzen uns.
Plötzlich verändert sich die Luft. Es riecht komisch. Ein Gas strömt ein. Man kann kaum mehr atmen. Die anderen werden panisch, springen übereinander, versuchen aus dem Behälter zu klettern. Schlagen um sich. Ich sitze in einer Ecke und keuche. Meine Angst ist so groß. Wird mich das Gas betäuben? Werde ich nichts merken? Mir wird schwummrig, doch ich bin nicht ganz ohnmächtig. Ich bin jetzt müde, doch kann ich immer noch meine Umgebung wahrnehmen. Ich habe solche Angst. Wird es wehtun? Ich weiß, dass es wehtun wird. Ich habe die anderen schreien gehört.
Einer nach dem anderen verschwinden die anderen wieder aus dem Behälter. Schreie. Bangen. Angst. Dann bin ich an der Reihe. Ich werde kopfüber aufgehängt. Es ist schmerzhaft. Ich spüre einen tiefen Schnitt, so qualvoll, dass es mir den Atem raubt. Dann greift der Mann meinen Pelz und zieht. Mit ihm entschwindet auch mein Leben.
Mein Körper wird gemeinsam mit den anderen im Hinterhof verbrannt. Meine Haut ist jetzt ein Pelzkragen. Getragen von Menschen, die vielleicht nicht einmal wissen, dass ihr Kleidungsstück gelebt hat. Bin ich für euch nur ein wertloses Objekt? Ein Accessoire? Kein Leben? Mein ganzes Leben war eine Qual. Eine Qual von Anfang bis zum Ende. Mein Tod war Schmerz.
So wie diesem Fuchs ergeht es hundert Millionen Tieren im Jahr. Marderhunde, Nerze, Waschbären, Kaninchen, Katzen. Kein Tier soll leiden und sterben für Mode. Bitte tragt keinen Pelz!
Video
Sandy P. Peng mit ihrer Rede "Ich bin ein Fuchs" bei der Pelzdemo im November 2018 in Wien.