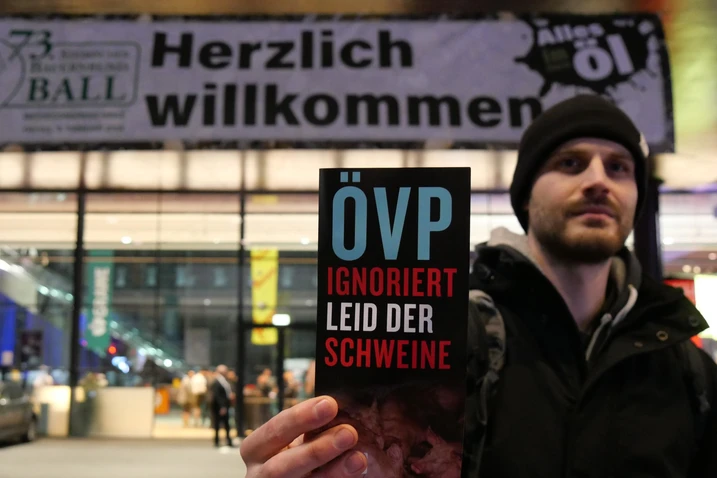Hinweis: Der Inhalt dieses Beitrags in Wort und Bild basiert auf der Faktenlage zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung (04.08.2020)
Wien, 04.08.2020
Die kontroverse Debatte um die Almwirtschaft in Österreich geht weiter
Abseits von dem Bild, das viele Menschen in Österreich von „der Alm“ haben, stellen sich aus Tierschutz-Sicht spannende Fragen. In diesem Text wollen wir auf einige dieser Fragen eingehen.
- Nimmt die Almwirtschaft wilden Tieren den Lebensraum weg?
- Was ist mit den Rindern, die jetzt auf Almen stehen?
Der Tierschutz befasst sich natürlich nicht nur mit den Bedürfnissen von bestimmten, ausgewählten Tieren, sondern sollte alle Tiere im Blick haben. An kaum einem anderen Ort wird der Spannungsbereich zwischen dem Schutz von domestizierten Tieren und freilebenden, wilden Tieren so deutlich wie auf der Alm. Dem VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN ist es deshalb wichtig, Tierschutz für alle Tiere zu vertreten.
Die Alm und Wildtiere
Almen sind von Menschen geschaffene Weideflächen für domestizierte Tiere – sie sind keine „natürlich“ entstandenen Biotope. Während der Lebensraum für Wildtiere von der Vergangenheit bis heute immer weiter schwindet, stellen Almen einen weiteren „Raum“ dar, der landwirtschaftlich genutzt wird. Letztlich führte der Lebensraumverlust für Wildtiere sowie die intensive Jagd auch zum Aussterben unzähliger Tierarten (z.B. Bisons oder auch Elche). Almen stellen bis heute keine natürlichen Lebensräume für große Wildtiere dar. Wolf, Bär und Co. werden bejagt, wenn sie mit menschlichen Interessen in Konflikt geraten. Große pflanzenessende Wildtiere stehen in der Konkurrenz zu den domestizierten Rindern. Österreichweit werden auf Almen jährlich ca. 7000 Murmeltiere geschossen, weil die von ihnen gegrabenen Löcher angeblich bei Kühen zu Verletzungen führen können. Zusätzlich gefährdet eine Übernutzung der Almfläche auch den sensiblen Lebensraum. Stehen viele Rinder auf einer Alm, kann das zu Bodenerosion durch die Verletzung der Grasnarbe oder zu Überdüngung der Böden und Verschmutzung von Gewässern führen. Wenn für die Almwirtschaft eigens Wälder gerodet werden, kommt es zu einer weiteren Einschränkung natürlicher Lebensräume für viele Wildtiere.
Die Rinder auf der Alm
Ein Großteil der Rinder in Österreich wird ihr Leben lang in Ställen gehalten. Einige davon werden vor allem über die Sommermonate auf Almen aufgetrieben. Die Haltung auf der Alm deckt im Vergleich zur Stallhaltung mehr Bedürfnisse der Rinder ab. Sie können sich weitestgehend frei bewegen und haben selbstverständlich mehr Platz als im Stall. Aber auch die Almhaltung hat ihre Schattenseiten. Almen sind keine „natürlichen“ Lebensräume für Rinder – sie sind seit Jahrtausenden viel mehr auf flachere Weideflächen im Tal angepasst. Somit kommt es leider auch immer wieder zu Unfällen, Verletzungen oder gar Todesfällen, z.B. durch Abstürze. Eine weitere äußerst kritische Praxis sind Kuhglocken. Bis zu 113 Dezibel können große Kuhglocken erreichen und führen laut einer Schweizer Studie auch zu verringerter Nahrungsaufnahme und langsamerem Kauen – die Kühe wollen damit den Lärm der Glocken minimieren. Davon abgesehen gibt es in Österreich jedoch ohnehin zu viele Rinder (fast 1,9 Millionen), um alle unter diesen „besseren“ Bedingungen halten zu können. Die Milch-Überproduktion, Rinderexporte und die umfassend kritisierten Kälber-Langstreckentransporte sind weitere Symptome dieser Landwirtschaft.
Abwägung für den Tierschutz
Wie schon erwähnt, stellt die Alm keinen natürlichen Lebensraum dar. Historisch und auch aktuell verdrängt die Alm natürliche Lebensräume und Wildtiere. Gleichzeitig stellt sie zumindest in einigen Bereichen (zeitweise) Haltungsverbesserung für die gehaltenen Rinder dar. Insofern muss aus Tierschutz-Sicht, die tatsächlich alle Tiere beachtet, die Almwirtschaft durchaus auch kritisch gesehen werden. Es muss Abwägungen geben und es müssen auch die Bedürfnisse und Rechte von freilebenden Wildtieren beachtet werden.