Hinweis: Der Inhalt dieses Beitrags in Wort und Bild basiert auf der Faktenlage zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung (02.07.2012)
02.07.2012
Die AMA - Agrarmarkt Austria
von Mag. jur Eberhart Theuer, Jurist
Fünf Thesen zur AMA
(Unterlage zur Pressekonferenz am 2.7.2012)
These 1: Die AMA ist einerseits eine Körperschaft öffentlichen Rechts, andererseits eine GmbH – beide werden nicht durch Wahlen, sondern von den Kammern besetzt. Zivilgesellschaftliche Kräfte werden dabei nicht berücksichtigt.
These 2: Die AMA hat zwei entgegenwirkende Aufgaben: Marketing und Qualitätssteigerung. Jedenfalls Fleisch betreffend konzentriert sich die AMA vor allem auf Marketing.
These 3: Die AMA-Gütesiegel sollten (wie die AMA selbst angibt) dem Zweck der Qualitätssicherung dienen. Die AMA hat aber ihre Marketing GmbH für die Gütesiegel zuständig gemacht. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass sich die Gütesiegel im Wesentlichen als Marketinggag erweisen und praktisch nichts zur Qualitätssteigerung beitragen, da sie etwa im Bereich der Schweinemast, um nichts strenger sind, als die Vorgaben der Tierhaltungsverordnung.
These 4: Diese Vorgaben der Tierhaltungsverordnung entsprechen großteils nicht dem Tierschutzgesetz und sind insofern verfassungswidrig. Ein Gütesiegel, das seinen Namen verdient, müsste im Hinblick auf Tierschutz wesentlich strengere Kriterien festsetzen als diese Verordnung.
These 5: Die vorhin geschilderte Situation lässt es überlegenswert erscheinen, Gütesiegel nicht einer Körperschaft bzw. GmbH wie der AMA zu überlassen, sondern konkret gesetzlich zu regeln. Die AMA sollte um Mitglieder aus der Zivilgesellschaft (Vertreter von Tierschutz-, Umweltschutz- und Konsumentenschutzorganisationen) erweitert werden, damit ihre Kompetenzen und Leistungen in den entsprechenden Bereichen verbessert werden.
A. Die AMA und die AMA Marketing
Zwei unterschiedliche juristische Gebilde tragen den Namen AMA:
Die Agrarmarkt Austria (AMA) ist eine durch das AMA-Gesetz im Jahre 1992 geschaffene juristische Person des öffentlichen Rechts. Im Langtitel dieses Gesetzes wird sie auch als „Marktordnungsstelle“ bezeichnet. Sie trat an die Stelle der Milchwirtschafts-, Getreidewirtschafts- und Mühlenfonds sowie der Vieh- und Fleischkommission (§ 2 Abs 1 AMA-Gesetz).
Die Agrarmarkt Austria Marketing GesmbH (AMA Marketing) „ist eine 100%ige Tochter der Marktordnungsstelle AMA“.1 Laut Eigendefinition ist sie u.a. zuständig für die Erarbeitung von „Qualitätssicherungsprogrammen“ wie das AMA-Gütesiegel, oder das AMA-Biozeichen.2 Es handelt sich bei diesen Siegeln nicht um gesetzlich normierte Siegel oder Gütezeichen3 und, da die AMA Marketing privat eingerichtet ist, nicht einmal um Siegel einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft. Die AMA Marketing ist insofern grundsätzlich frei in der Wahl der von ihr geschaffenen Gütezeichen und von deren Kriterien. Insofern unterscheiden sich AMA-Gütezeichen nicht von anderen privaten Gütezeichen, -siegeln etc. Freilich ist die AMA für ihre Tochter AMA Marketing verantwortlich und darf die AMA auch über die AMA Marketing nur im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages tätig werden. Dazu gehören „Maßnahmen zur Qualitätssteigerung, wie insbesondere Entwicklung und Anwendung von Qualitätsrichtlinien für agrarische Produkte und daraus hergestellte Verarbeitungserzeugnisse“ und die „Förderung des Agrarmarketings“. Dritte (und im Gesetz erstgenannte Aufgabe der AMA) im eigenen Wirkungsbereich ist die „Markt- und Preisberichterstattung“ über Agrarprodukte und daraus abgeleitete Erzeugnisse sowie landwirtschaftliche Produktionsmittel (§ 3 Abs 2 AMA-Gesetz; vgl auch § 21a leg cit hinsichtlich der Verwendung des AMA-Beitrages).
Im „übertragenen Wirkungsbereich“ hat die AMA behördliche
Marktordnungsaufgaben der oben genannten Fonds zu vollziehen
(§ 3 Abs 2 AMA-Gesetz, vgl auch § 6 Abs 1 MOG).
Es fällt auf, dass die AMA zwei Aufgaben hat, die miteinander
in Konflikt geraten können: Qualitätssteigerung, was eine
ehrliche Qualitätsevaluation und -kontrolle bedingt und
Marketingförderung, was impliziert, dass die Qualität nach
außen hin positiv dargestellt wird. Es ist fraglich, ob
diese gegenläufigen Aufgaben sinnvollerweise von ein- und
derselben Institution wahrgenommen werden sollten. Derzeit
erweckt die AMA den Eindruck, als würde sie ihre Marketingaufgabe
über jene der Qualitätssteigerung stellen (siehe unten,
zu den Siegeln).
Finanziert wird die AMA durch Zwangsbeiträge, die von den
jeweiligen „Produzenten“ (Schlachthöfe, Molkereien) zu entrichten
sind. Fleischbauern werden dabei gegenüber Gemüse- und Obstbauern
oder gegenüber Gartenbaubetrieben insofern bevorzugt, als
nicht sie, sondern die Schlachthöfe die Beiträge zu entrichten
haben (vgl § 21e AMA-Gesetz).
Hinsichtlich der Struktur der AMA fällt auf, dass die AMA
anders als andere Zwangsbeiträge einhebenden Körperschaften
öffentlichen Rechts (AK, Wirtschaftskammer, ÖH) nicht demokratisch
organisiert ist und die Beitragszahler auch nicht Mitglieder
sind. Der Vorstand der AMA führt deren Geschäfte und vertritt
diese nach außen. Er wird vom „Verwaltungsrat“ bestimmt,
dieser besteht aus je drei Mitgliedern der Landwirtschafts-,
der Wirtschafts- und der Bundesarbeitskammer sowie des ÖGB.
Damit werden im „Verwaltungsrat“ weder die Interessen der
Tiere noch Umweltschutzbelange institutionalisiert berücksichtigt.
Konsumentenschutzinteressen werden allenfalls indirekt über
die Mitglieder der Bundesarbeitskammer berücksichtigt.
Mitglieder aus den genannten Institutionen beschicken auch
den Kontrollausschuss.
Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt
und Wasserwirtschaft ist gegenüber der AMA weisungsbefugt
(§ 27 AMA-Gesetz).
Es wäre eine wichtige institutionelle Stärkung von Tier-,
Umwelt- und Konsumentenschutzanliegen sowie ein Schritt
vom Kammerstaat zu einer Demokratie moderner Prägung, würden
durch eine Novelle des AMA-Gesetzes auch zivilgesellschaftliche
Kräfte wie Vertreter von Tier-, Umwelt- und Konsumentenschutzorganisationen
in Verwaltungsrat und Kontrollausschuss miteinbezogen.
Das AMA-Biozeichen setzt die Erfüllung von entsprechenden Standards des österreichischen Lebensmittelbuches (Codex Alimentarius Austriacus) bzw der Bio-EG-VO (Nr. 834/2007) voraus. Dass Produkte mit dem AMA-Biozeichen den Standards der Bio-EG-Verordnung und (in Österreich) dem Lebensmittelbuch entsprechen müssen, ist allerdings bloß eine rechtliche Selbstverständlichkeit, denn dazu verpflichtet bereits die EU-Verordnung bzw das Lebensmittelbuch selbst: Die VO sieht vor, dass alle Produkte, die den Eindruck erwecken, „bio“ zu sein, die Kriterien der Verordnung erfüllen müssen. Nach dem Lebensmittelbuch gelten nur solche Betriebe als biologisch, welche die entsprechenden Bestimmungen der Verordnung und des Lebensmittelbuches erfüllen und sich einem Kontrollverfahren unterziehen. Insofern verpflichtet das AMA-Biozeichen zu nichts anderem als zur Einhaltung der entsprechenden EU-Verordnung bzw. des Lebensmittelbuches. Auch ohne AMA-Biozeichen müsste jedes Produkt, das von sich behauptet „bio“ zu sein (oder auch nur diesen Eindruck erweckt), der genannten Verordnung und (in Österreich) dem Lebensmittelbuch entsprechen.
Das AMA-Gütesiegel verpflichtet nicht einmal dazu. Es orientiert sich an keinem über den gesetzlichen Mindeststandards angesiedeltem System, sondern an den Minimalbestimmungen für sogenannte konventionelle (Massentier-)Haltung.
So ist für Schweine mit einem Körpergewicht von über 110kg ein Mindestplatzbedarf von einem Quadratmeter vorgesehen.4 Natürliches Licht muss lediglich durch Öffnungen fallen die 3% der Stallbodenfläche entsprechen. Genauso steht es in der entsprechenden Verordnung zum Tierschutzgesetz (1. Tierhaltungsverordnung). Damit verpflichtet das AMA-Gütesiegel die Schweinemastbetriebe bloß zu einer Selbstverständlichkeit: nämlich dazu, die Tierschutzbestimmungen einzuhalten. Ihren gesetzlichen Auftrag, einer Qualitätssteigerung erfüllt die AMA damit nicht. Schon eher kommt sie damit ihrer Marketingaufgabe nach, wenn auch nicht in besonders seriöser Form: Die Einhaltung gesetzlicher Mindeststandards wird als besonderes Qualitätsmerkmal dargestellt. Von daher ist es signifikant, dass nicht die AMA sondern die AMA Marketing für die Gütesiegel zuständig sind. Offenbar sieht die AMA (auch wenn sie anderes behauptet) diese Sigel primär als Marketinginstrument und nicht als Maßnahme zur Qualitätssteigerung.
Die hinter den Anforderungen des AMA-Gesetzes zurückbleibenden Leistungen der AMA bei den Gütesiegeln sowie die teilweise gegenläufigen AMA-Aufgaben „Qualitätssteigerung“ und „Marketing“ lassen es erwägenswert erscheinen, die Gütesiegel einer Neuregelung zu unterziehen. Da qualitativ hochwertige, nachvollziehbare und den Tierschutz berücksichtigende Gütesiegel ein öffentliches und gesamtgesellschaftliches Anliegen sind, erscheint es sinnvoll, konkrete Mindestregelungen für solche Siegel gesetzlich festzulegen, etwa im Rahmen des AMA-Gesetzes. Eine solche Regelung durch das Parlament wäre auch aus demokratiepolitischer Sicht für dieses wichtige, alle Konsumenten betreffende Thema angemessner als eine Festlegung durch eine GmBH wie AMA Marketing. Der AMA könnte dabei die Möglichkeit eingeräumt werden, die Anforderungen für die Siegel noch weiter anzuheben und somit dem Stand der Wissenschaft und der sich ändernden Einstellung der Bevölkerung zum Tierschutz anzupassen.
B. Zum Tierschutzgesetz und seinem Verhältnis zu konkreten Mindestbestimmungen
Das österreichische Tierschutzgesetz (TSchG) bietet Tieren einen vergleichsweise weitgehenden Schutz. Tiere werden als Mitgeschöpfe bezeichnet für deren Leben und Wohlbefinden der Mensch eine besondere Verantwortung hat (§ 1 TSchG). Der Staat wird verpflichtet „das Verständnis der Öffentlichkeit und insbesondere der Jugend für den Tierschutz zu wecken und zu vertiefen“ und „nach Maßgabe budgetärer Möglichkeiten tierfreundliche Haltungssysteme, wissenschaftliche Tierschutzforschung sowie Anliegen des Tierschutzes zu fördern.“
Nach § 5 TSchG begeht Tierquälerei, wer ein Tier einer Bewegungseinschränkung aussetzt und ihm dadurch Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere Angst zufügt.
Tiere dürfen nur gehalten werden wenn „davon ausgegangen werden kann, dass die Haltung nach dem anerkannten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse ihr Wohlbefinden nicht beeinträchtigt (§ 13 Abs 1 TSchG). „Wer ein Tier hält, hat dafür zu sorgen, dass das Platzangebot, die Bewegungsfreiheit, die Bodenbeschaffenheit, die bauliche Ausstattung der Unterkünfte und Haltungsvorrichtungen, das Klima, insbesondere Licht und Temperatur, die Betreuung und Ernährung sowie die Möglichkeit zu Sozialkontakt unter Berücksichtigung der Art, des Alters und des Grades der Entwicklung, Anpassung und Domestikation der Tiere ihren physiologischen und ethologischen Bedürfnissen angemessen sind“ (§ 13 Abs 2 TSchG).
„Die Bewegungsfreiheit eines Tieres darf nicht so eingeschränkt sein, dass dem Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt werden oder es in schwere Angst versetzt wird“ (§ 16 Abs 1 TSchG). Das Tier muss über einen Platz verfügen, der seinen physiologischen und ethologischen Bedürfnissen angemessen ist (§ 16 Abs 2 TSchG).
Unter Berücksichtigung dieser Prinzipien hat der bzw die zuständige(n) Bundesminister Mindestanforderungen für die Haltungsbedingungen in Verordnungsform zu erlassen (§ 24 TSchG) Für sogenannte Nutztiere geschah dies in der 1. Tierhaltungsverordnung. Verordnungen haben Gesetze näher zu konkretisieren und dürfen diesen nicht widersprechen. Verordnungen, die dem Sinn von Gesetzen zuwiderlaufen sind gesetzes- und damit verfassungswidrig und vom VfGH, wenn er damit befasst wird, aufzuheben.
Zahlreiche Bestimmungen der 1. Tierhaltungsverordnung
lassen sich nur schwer in Einklang mit den Regelungen des
Tierschutzgesetzes bringen. So ist etwa die im Tierschutzgesetz
verankerte Bewegungsfreiheit durch die Minimalforderungen
an Platzbedarf in vielen Fällen nicht gewährleistet. Das
Extrembeispiel der Kastenstände (körperenge Gitterkäfige
für Zuchtsauen) veranlasste sogar die Volksanwaltschaft
dazu, hier eine Gesetzeswidrigkeit der Verordnung festzustellen
und sich an den Verfassungsgerichtshof zu wenden.
Vor diesem Hintergrund müsste selbst ein Gütesiegel, das
bloß für sich in Anspruch nimmt den Mindeststandards des
Tierschutzgesetzes genügen zu wollen über die in der 1.
Tierhaltungsverordnung niedergelegten Minimalkriterien hinausgehen.
Freilich impliziert der Begriff Gütesiegel aber
mehr als das, nämlich einen substantiellen, positiven Qualitätsunterschied
zu gesetzlichen Mindeststandards.
C. Zusammenfassung
-
Die AMA kommt ihrer gesetzlichen Aufgabe der Qualitätssicherung nicht ausreichend nach.
-
Das AMA-Gütesiegel ist kein substanzieller Fortschritt gegenüber tierschutzgesetzlichen Mindestvorgaben. Geht man davon aus, dass die Tierhaltungsverordnung nicht dem Tierschutzgesetz entspricht, bleibt das Gütesiegel sogar hinter gesetzlichen Mindesthaltungsbedingungen zurück.
-
AMA und AMA-Gesetz sind reformbedürftig, die Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Kräfte notwendig. Gütesiegelkriterien sollten gesetzlich festgelegt werden.


_Link_26581_1_d4f718cd88e8d9fba05a08d07739a526.webp)



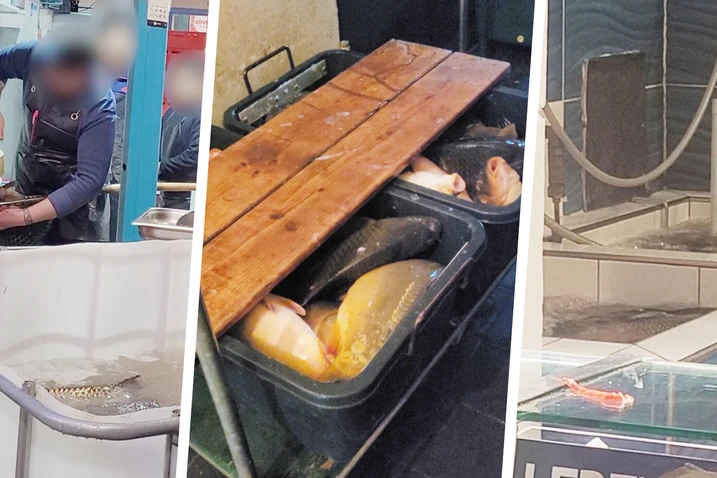
_Link_26562_1_f7fc3ddad857c5ec091e45c237463fbf.webp)
